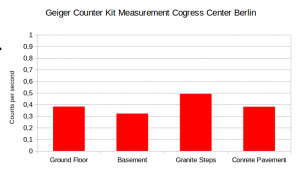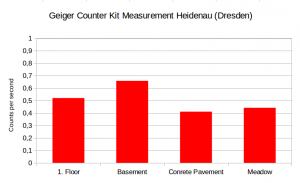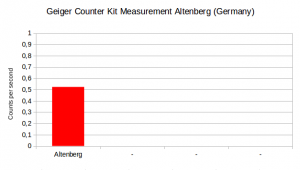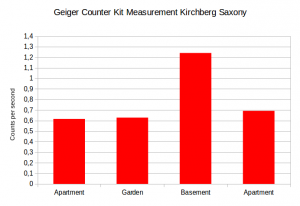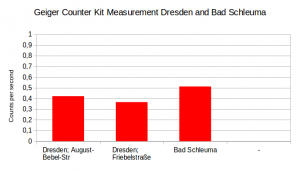Das Thema Naturwissenschaft ist sehr vielfältig, weshalb ich nur einige wenige Aspekte in stichpunktartiger Form darlegen möchte. Diese Stichpunkte möchte ich in Form von Fragen erläutern.
Was ist Naturwissenschaft?
Ich habe mal einen schönen Spruch gehört, der die Frage nach der Naturwissenschaft auf den Punkt bringt: „Naturwissenschaft ist die Summe aller möglichen Experimente.“
Was ist ein Experiment?
Die Beantwortung dieser Frage führt zu der Aussage, wie ein wissenschaftliches Experiment aufgebaut sein muss und welche Anforderungen es erfüllen muss: „Ein Experiment ist eine genau definierte, präparierte Situation, bei der alle störenden Variablen ausgeschaltet oder kontrolliert werden und eine unabhängige Variable durch den Experimentator gezielt verändert wird. Ziel des Experiments ist die Beobachtung der Auswirkungen der Veränderung der unabhängigen Variable auf alle anderen abhängigen Variablen.“
Was ist das Wesen eines Experiments?
Unser Verständnis der Natur ist begrenzt. Gerade die Tatsache dieses begrenzten Verständnisses macht das Experiment für uns so wertvoll. „Im Experiment beobachtet man immer das gesamte Universum. Gerade die Experimente mit einem unerwarteten Ergebnis sind besonders wertvoll, weil sie die Grenzen des Wissens erweitern.“
Was bedeutet Messen?
„Jede Maßeinheit ist das Ergebnis eines genau definiertes Experiments. Messen ist nichts weiter als der Vergleich einer beobachteten Größe mit dem Ergebnis des Experiments, das die Maßeinheit definiert.“ Selbst wenn wir die Natur nicht verstehen, können wir sie durch das Messen beschreiben.
Was ist eine physikalische Größe?
„Eine physikalische Größe ist das Produkt aus einer Zahl und einer Maßeinheit.“
Was ist eine Theorie?
„Eine Theorie ist ein Modell, mit dem die Beobachtungen in einem Experiment erklärt werden können. Es kann hierbei nur die Aussage getroffen werden, dass eine Theorie in einem konkreten Experiment zutreffend oder nicht zutreffend war, mehr nicht.“ Theorien werden oft dazu genutzt, um Vorhersagen über den Ausgang von Experimenten zu machen. Im Grunde genommen handelt es sich hierbei nie um Vorhersagen sondern um Schätzungen. Die Schätzungen können zutreffend sein, wenn keine anderen Störgrößen auftreten, die durch die verwendete Theorie nicht beschrieben werden.
Experimentelle Praxis in vielen Unternehmen
Viele Unternehmen stürzen sich im Blindflug in Vorhaben, ohne jemals ihre Vorhaben auf eine wissenschaftlich experimentelle Basis gestellt zu haben. Wie oft habe ich den Satz schon gehört „Das was wir vorhaben, kann man sowieso nicht berechnen. Wir müssen das einfach ausprobieren.“ So werden in vielen Unternehmen Experimente sträflich vernachlässigt. Entweder werden Experimente einfach nicht durchgeführt oder wenn sie durchgeführt werden, werden vermeintlich aus Zeitmangel die Störfaktoren in Experimenten nicht gesucht, nicht erkannt, nicht ausgeschaltet und nicht kontrolliert. Die Versuchsapparaturen werden nicht dokumentiert. Die Messgeräte werden schlecht behandelt, nicht gewartet, nicht regelmäßig geeicht. Experimente werden oft einfach so nebenbei im stressigen Alltag halbherzig ausgeführt.
Vorteile einer wissenschaftlich experimentellen Basis im Alltag
Der Philosoph Epikur hat es schön formuliert: „Der überwindet die Unsicherheit gegenüber seiner Umwelt am besten, der sich so weit als möglich mit ihr vertraut macht und, wo dies unmöglich ist, dafür sorgt, dass sie ihm nicht fremd ist. Mit allem aber, bei dem ihm nicht einmal dies gelingt, lässt er sich gar nicht ein und stützt sich nur auf das, was ihm hilft, sicher zu werden.“
Das, was wir wirklich wissen, ist letztendlich das, was wir im Experiment beobachten können. Erst durch Wissen und Erkenntnis sind wir in der Lage, mit komplexen Sachverhalten zurechtzukommen, ohne zu viele Erfahrungen in Form von Rückschlägen teuer bezahlen zu müssen.